
Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) weisen bei gleichem Energieertrag wie andere Kraftwerke eine vergleichsweise hohe Spitzenleistung auf. Die Spitzenleistung ist zwar für den Energieertrag nur wenig relevant, belastet jedoch die Netzinfrastruktur erheblich. Obwohl im Jahr 2024 jede zweite neue PV-Anlage mit einem Batteriespeicher ans Netz angeschlossen wurde, beantragten laut Netzbetreibern fast alle die maximale Wechselrichterleistung als Netzanschlusskapazität. Dies führt zu einem teuren und ineffizienten Ausbau der Stromnetze. Kostengünstiger wäre es, den Netzausbau zu begrenzen und stattdessen PV-Anlagen netzdienlich anzulegen.
Die Grafik (vgl. Beilage) zeigt am Beispiel einer typischen Ost-West-Anlage im Mittelland, wie stark einzelne Leistungsbereiche zum Energieertrag im Sommer und im Winter beitragen.
Da Netze auf Leistung – nicht auf Energie – ausgelegt werden müssen, entfallen vereinfacht gesagt die Hälfte der Netzkosten auf nur 12 Prozent des Energieertrags. Im Winter, wenn der Solarstrom besonders wertvoll ist, ist dieser Anteil noch geringer. Sommerliche Ertragsspitzen, die das Netz am stärksten fordern, haben gemäss einer Studie der BFH und Swissgrid kaum Marktwert. Das Netz wird also für Strom mit geringem ökonomischem Nutzen ausgebaut.
Anreize für netzdienliches Verhalten schaffen
PV-Anlagen beteiligen sich wie andere Kraftwerke nicht an den Netzkosten. Die Stromverbraucherinnen und - verbraucher tragen die gesamten Kosten. Deshalb bestehen keine wirtschaftlichen Anreize für PV- Anlagen, netzschonend zu operieren. Obwohl entsprechende Technologien – insbesondere Batteriespeicher – weit verbreitet sind, werden sie bisher kaum zur Netzstabilisierung eingesetzt.
Der Vorschlag der BFH-Forschenden ist bestechend einfach: Wer sich freiwillig verpflichtet, die maximale Einspeiseleistung der PV-Anlage zu begrenzen, soll anteilsmässig an den eingesparten Netzausbaukosten beteiligt werden. Christof Bucher, Leiter des Labors für Photovoltaiksysteme an der Berner Fachhochschule, erklärt: «Die Prozesse zur Umsetzung bestehen bereits weitgehend. Das Anschlussgesuch beim Netzbetreiber und der Sicherheitsnachweis für die Elektroinstallation ermöglichen eine zuverlässige Abschätzung der Netzbelastung.»
Ertragsverluste gering halten
Ziel des Vorschlags ist es, den Energieertrag der PV-Anlagen möglichst vollständig zu nutzen, ohne das Netz unnötig zu belasten. Strom, der nicht eingespeist werden kann, soll lokal verbraucht werden – etwa durch den Betrieb einer Wärmepumpe, eines Warmwasserboilers tagsüber, das Laden eines Elektroautos oder den Einsatz eines Batteriespeichers. Welche Lösung sinnvoll ist, soll die Bauherrschaft selbst entscheiden. «Für jedes Projekt kann eine andere Lösung optimal sein. Genau das ist die Stärke des Modells: Entschädigt wird dafür, dass das Netz nicht belastet wird», so Bucher. Wie das Geld verwendet wird, liegt im Ermessen der Betreiberinnen und Betreiber der PV-Anlage.
Kostenneutral für die Energiewende
Klar ist: Die Energiewende wird anspruchsvoll – auch für die Stromnetze. Insbesondere die Netzbetreiber rechnen mit hohen Investitionen. Der Vorschlag der BFH für Anreize zum netzdienlichen PV-Anschluss soll kostenneutral umgesetzt werden können: Ein Teil der eingesparten Mittel aus vermiedenen Netzausbauten wird gezielt an jene Anlagen zurückgeführt, die zur Entlastung beitragen.
Über das Institut für Energie- und Mobilitätsforschung IEM
Das Institut für Energie- und Mobilitätsforschung (IEM) der Berner Fachhochschule Technik und Informatik widmet sich der Erforschung technischer Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung und Mobilität der Zukunft. Die Forschungsschwerpunkte liegen auf elektrischen Energiespeichern und Wandlern, der Energieversorgung und Energieverteilung sowie auf energieeffizienter Mobilität. Mit insgesamt zehn Laboren, darunter das Labor für Photovoltaiksysteme, arbeitet das IEM interdisziplinär an praxisnahen Lösungen.
Labor für Photovoltaiksysteme
Das Labor für Photovoltaiksysteme ist Teil des Instituts für Energie- und Mobilitätsforschung IEM. Es fokussiert auf drei Schwerpunkte: auf Wechselrichter und deren Netzanschluss, auf PV-Komponenten wie Module und Steckverbindungen sowie auf komplexe PV-Systeme, etwa in der Agrivoltaik oder im alpinen Raum. Im Zentrum stehen praxisnahe Messungen zur Qualität und Leistungsfähigkeit von PV- Technologien. Gemeinsam mit dem Labor für Elektrizitätsnetze entsteht derzeit ein Smart Grid Lab, in dem technische Lösungen für die Energiewende realitätsnah getestet und für den Einsatz qualifiziert werden.
Kontakte
Bettina Huber
Medienverantwortliche
Berner
Fachhochschule
Technik und Informatik
+41 32 321 63 79
Hoch individualisierte Lehre und starke Forschung: Als erste transdisziplinäre Kunsthochschule der Schweiz bietet die Hochschule der Künste Bern HKB ein vielfältiges Studienangebot in den Fachbereichen Musik, Gestaltung und Kunst, Konservierung und Restaurierung, Theater sowie Literatur an.
Forschung an der Hochschule der Künste Bern HKB verbindet wissenschaftliche und künstlerische Ansätze, ist praxisnah und folgt kulturwissenschaftlichen, technologischen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. In vier Instituten forschen transdisziplinäre Teams aus den Künsten sowie Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften.
Die HKB ermöglicht ihren Studierenden eine über alle drei akademischen Bildungsstufen führende Ausbildung bis hin zum Doktoratsprogramm (in Zusammenarbeit mit der Universität Bern) und legt Wert auf eine Lehre, die den Wandel der Berufswelt berücksichtigt. Ausgezeichnete Infrastruktur, Orientierung an neuesten künstlerischen und wissenschaftlichen Entwicklungen, innovative Lehrformen, eine überschaubare Grösse mit familiärer Atmosphäre sowie die Lage in den Kulturstädten Bern und Biel tragen zur Einzigartigkeit der Hochschule der Künste Bern bei.
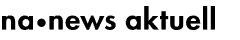

| Berner Fachhochschule (Firmenporträt) | |
| Artikel 'Anreize für einen systemdienlichen Netzanschluss von Photovoltaikanlagen...' auf Swiss-Press.com |
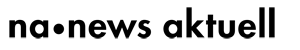

SBV-Zentralpräsident Lardi: «Die Möglichkeiten zur Einsprache sollten eingeschränkt werden»
Schweizerischer Baumeisterverband (SBV), 30.06.2025Ein Viertel der getesteten Verkaufspunkte haben im 2024 Alkohol an Jugendliche verkauft
Sucht Schweiz, 30.06.2025Die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV im internationalen Vergleich
Schweizerische Exportrisikoversicherung, 30.06.2025
05:01 Uhr 
Diebe klauen Ferraris und BMWs: Polizei warnt Luxusautohändler »
22:22 Uhr 
«Wir bleiben regional verankert – das ist die Seele der SRG» »
18:12 Uhr 
Geschäftsjahr 2025: Swiss Marketplace Group rechnet mit ... »
18:11 Uhr 
Gegen den Zickzack-Kurs im Supermarkt »
17:31 Uhr 
KOMMENTAR - Hat Trump in Kongo einen der schlimmsten Konflikte ... »
19 Crimes Cabernet Sauvignon/Syrah South Eastern Australia
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

19 Crimes Chardonnay South Eastern Australia - Chard
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

19 Crimes Red Blend South Eastern Australia - The Banished
CHF 11.95 statt 14.95
Coop

Aargau AOC Blauburgunder Falkenkönig Weinkeller zum Stauffacher
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

Aargau AOC Blauburgunder Falkenkönig Weinkeller zum Stauffacher
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

Aargau AOC Müller-Thurgau Besserstein
CHF 14.35 statt 17.95
Coop

Aktueller Jackpot: CHF 2'569'703